„The question is not, Can they reason? nor, Can they talk? but, Can they suffer?”
Eine philosophische Reise durch 2,500 Jahre Nachdenken über unser Verhältnis zu Tieren
Sind Tiere nur Sachen? Werkzeuge für menschliche Zwecke? Oder haben sie einen eigenen moralischen Wert, der uns zu Rücksicht und Respekt verpflichtet? Diese Fragen beschäftigen uns heute intensiver denn je, in Debatten über Massentierhaltung, Tierversuche, Veganismus und Artenschutz. Doch sie sind keineswegs neu. Philosophen streiten seit über 2,500 Jahren darüber, welchen Platz Tiere in unserem moralischen Universum einnehmen sollen.
Die Geschichte und Entwicklung der Tierethik ist faszinierend, weil sie zeigt, wie sehr unsere Einstellungen zu Tieren von Weltbildern, wissenschaftlichen Erkenntnissen und – seien wir ehrlich – auch von unseren Interessen geprägt wurden. Wie Reinhard Margreiter treffend bemerkt: „Sehr oft folgen die Philosophen bloß dem kulturellen Mainstream und geben ihm eine begrifflich-theoretische Gestalt” (Margreiter 2019). Werfen wir einen Blick auf diese Entwicklung: von den antiken Griechen über das finstere Mittelalter bis zur philosophischen Revolution der Moderne.
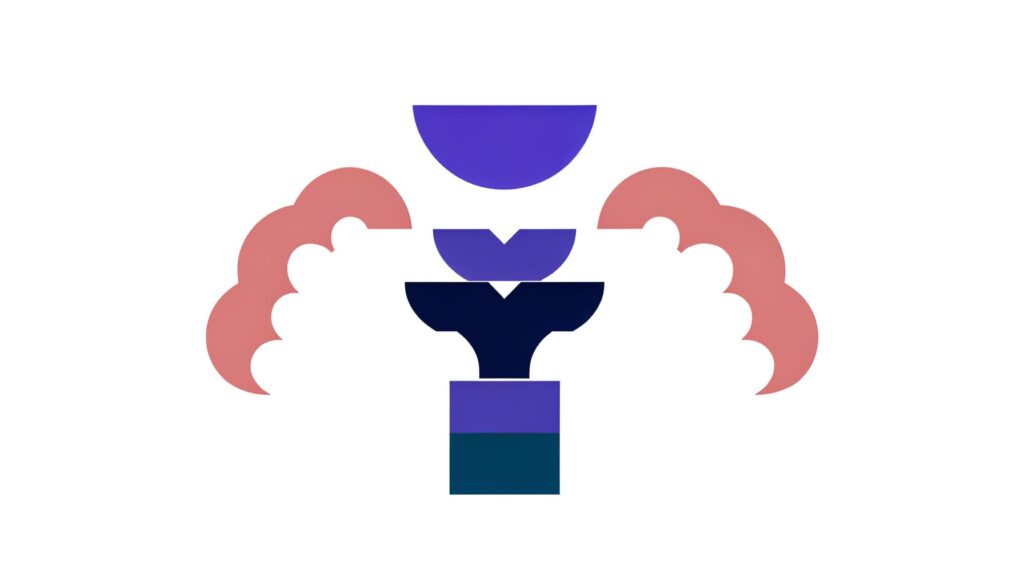
ToC: Entwicklung der Tierethik
Die Antike: Wo alles begann
Frühe griechische Denker – Tiere im mythischen Weltbild
In Homers Epen wimmelt es von Tieren: Adler, Löwen, Hunde begleiten Helden und Götter. Doch eine klare begriffliche Trennung zwischen Mensch und Tier gibt es noch nicht. Erst Hesiod, der Dichter des 8. Jahrhunderts v. Chr., führt die Idee ein, dass Gerechtigkeit etwas spezifisch Menschliches sei. Wie Margreiter ausführt, schreibt Hesiod: „Nur die Menschen hätten Rechtsempfinden und seien fähig, ihr Zusammenleben nach gerechten Prinzipien zu organisieren” (Margreiter 2019). Tiere, so die Vorstellung, leben nach dem Recht des Stärkeren – Menschen hingegen können gerechte Gemeinschaften bilden.
Diese Unterscheidung wird zum Fundament eines anthropozentrischen Weltbilds: Der Mensch steht im Zentrum, Tiere am Rand. Doch wie bei Platon die Frage der Gerechtigkeit in der Politeia komplex und vielschichtig behandelt wird, so gibt es auch in der Antike schon früh kritische Stimmen, die dieses einfache Bild infrage stellen.
Aristoteles: Die Hierarchie der Natur
Aristoteles (384-322 v. Chr.) gilt als Vater der Zoologie. In seinen biologischen Schriften beschreibt er mit bewundernswerter Genauigkeit das Verhalten von Tieren, attestiert ihnen praktische Klugheit (phronesis) und Gedächtnis. Doch philosophisch zieht er eine scharfe Grenze: „Der Mensch sei zoon logon echon und zoon politikon” (Aristoteles, Pol. I.2, 1253a9-18). Ein vernunftbegabtes und politisches Lebewesen. Tiere hingegen sind zoa aloga, „nicht-vernünftige Lebewesen”.
Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das über „Logos“ (Vernunft / Sprache) verfügt. Dies unterscheidet ihn von anderen sozialen Tieren, da nur der Mensch durch Sprache über das Gerechte und das Ungerechte, das Gute und das Schlechte kommunizieren kann
(Pol. I.2, 1253a9-10).
In der Nikomachischen Ethik macht Aristoteles klar: Nur der Mensch kann tugendhaft handeln und Glückseligkeit (eudaimonia) erreichen. Tiere können weder moralische Entscheidungen treffen noch an der Polis, der politischen Gemeinschaft, teilhaben. Sie sind, wie er in der Politik unmissverständlich formuliert: „Pflanzen existieren für die Tiere, Tiere und Pflanzen für den Menschen” (Aristoteles, Politik I,8).
Diese Dichotomie mit empirischer Anerkennung tierischer Intelligenz in der Biologie, philosophischer Abwertung in der Ethik, zieht sich durch die gesamte Philosophiegeschichte. Richard Sorabji identifiziert sie als fundamentale philosophische Krise:
„Aristoteles habe durch die Abtrennung der Wahrnehmung von der Vernunft eine folgenschwere philosophische Krise ausgelöst”
(Sorabji 1993)
Die Scala Naturae: Aristoteles’ Stufenleiter der Natur ordnet Lebewesen hierarchisch: Pflanzen existieren für Tiere, Tiere für Menschen. Diese teleologische Sichtweise prägt das europäische Denken für Jahrhunderte. Alles hat einen Zweck, und der Zweck der Tiere ist es, dem Menschen zu dienen.
Die Gegenstimmen: Plutarch, Theophrast, Porphyrios
Doch schon in der Antike gibt es Philosophen, die widersprechen. Plutarch (ca. 45-125 n. Chr.) schreibt in seinem Essay „Über die Klugheit der Tiere” (De sollertia animalium), dass Tiere sehr wohl Vernunft besitzen – nur anders als wir. Er beobachtet strategisches Denken bei Vögeln, Mitgefühl bei Elefanten, Treue bei Hunden. Seine zentrale These:
„Nur dem Grad, nicht der Qualität nach sei das menschliche Denken leistungsfähiger”
(Plutarch, Moralia)
In einem anderen Essay argumentiert er gegen Fleischkonsum: „Tiere sind ebenso schmerzempfindlich wie der Mensch” (ebd.). Und in einer bemerkenswert modernen Einsicht warnt er: „Wer roh zu Tieren sei, verhalte sich so auch Menschen gegenüber” (ebd.).
In der Entwicklung der Tierethik gibt es noch weitere Stimmen der Antike zu nennen.
- Theophrast (ca. 371-287 v. Chr.), Schüler und Nachfolger des Aristoteles, ging noch einen Schritt weiter. Er begründet ethische Rücksichtnahme auf Tiere nicht mit mystischen Ideen, sondern mit biologischer Ähnlichkeit. Seine Forderung: „Tiere müssten fair und rücksichtsvoll behandelt werden” (Theophrast, Fragmente, zit. n. Margreiter 2019). Blutige Tieropfer verurteilt er unmissverständlich: „Blutige Tieropfer seien ausdrücklich sinnlos und grausam” (ebd.).
- Porphyrios (234-305 n. Chr.) schreibt mit De abstinentia („Über die Enthaltung vom Beseelten”) ein ganzes Buch für den Vegetarismus. Seine Argumente sind vielfältig: „Fleischkonsum sei vulgär und unappetitlich und außerdem ungesund, sowohl physisch wie psychisch” (Porphyrios, De abstinentia). Seine Position fasst Margreiter zusammen: Fleisch störe die körperliche und psychische Harmonie des Menschen.
- Die Pythagoräer schließlich praktizieren vegetarische Lebensweise aus der Überzeugung der Seelenwanderung (Metempsychose): Wer weiß, ob im geschlachteten Tier nicht die Seele eines Verwandten wohnt? Das ist weniger ethische Tierliebe als pragmatische Vorsicht, aber es führt immerhin zu einem Verzicht auf Fleisch.
Stoiker vs. Skeptiker: Der philosophische Grundkonflikt
Die Stoiker – allen voran Chrysipp – entwickeln die Instinkttheorie: Tiere handeln instinktgetrieben, nicht vernunftgeleitet. Chrysipps Position ist eindeutig: „Mit ihnen kann es keine Rechtsgemeinschaft geben. Sie seien immer nur Mittel für unsere Zwecke” (zit. n. Margreiter 2019). Diese anthropozentrische Haltung wird das Christentum und die gesamte abendländische Philosophie prägen.
Die Skeptiker hingegen zweifeln an solchen Gewissheiten. Kann man wirklich so sicher sein, dass Tiere keine Vernunft besitzen? Ist das nicht eher eine bequeme Rechtfertigung für unsere Praktiken? Diese skeptische Tradition bleibt aber minoritär.
Ein interessantes Konzept, das in moderner Tierethik wieder auftaucht: Moral Patients vs. Moral Agents. Nicht alle, die moralische Rücksicht verdienen (Moral Patients), müssen selbst zu moralischem Handeln fähig sein (Moral Agents). Kleinkinder und Menschen mit schweren kognitiven Beeinträchtigungen sind Moral Patients, ohne Moral Agents zu sein. Plutarch hatte bereits erkannt: „Tiere besitzen einen Eigenwert, sie sind nicht einfach für den Menschen da” (Plutarch, Moralia).

Mittelalter und Frühe Neuzeit: Die lange Stagnation
Thomas von Aquin und die christliche Synthese
Das Mittelalter bringt philosophisch wenig Neues für die Tierethik. Margreiter konstatiert ernüchternd: Die mittelalterliche Philosophie habe „nichts substanziell Neues zur Tierethik beigetragen, sondern aristotelisch-stoische Positionen wiederholt” (Margreiter 2019).
Die Scholastiker, also mittelalterliche Philosophen, die aristotelisches Denken mit christlicher Theologie verbinden, verschärfen die antiken Positionen noch durch theologische Argumente. Voerst gab es keine weitere Entwicklung der Tierethik.
Thomas von Aquin (1225-1274), der einflussreichste Denker dieser Epoche, ist unmissverständlich: Tiere haben keine vernünftige Seele (anima rationalis), nur eine tierische Seele (anima sensitiva). Seine Position:
„Man dürfe die Tiere jagen, schlachten, essen und auch anderweitig gebrauchen. Denn Gott habe sie ausschließlich für uns geschaffen”
(Thomas von Aquin, Summa Theologiae).
In der Summa Theologiae schreibt Thomas: Grausamkeit gegenüber Tieren ist nur dann ein Laster, wenn sie den Menschen schadet. Etwa weil er dadurch die Gewohnheit entwickelt, auch gegen Menschen grausam zu sein. Das Tier selbst ist kein Gegenstand moralischer Rücksicht.
Diese Position wird für 500 Jahre die christliche Standardlehre bleiben. Der Neuplatonismus mit seiner Idee der All-Einheit (hen kai pan) – wonach alles Lebendige miteinander verbunden ist – hätte theoretisch Raum für Tierschutz geboten. Aber diese mystischen Strömungen bleiben philosophisch randständig.
Descartes und der Tiermaschinismus
René Descartes (1596-1650) treibt die Abwertung der Tiere auf die Spitze. In seiner mechanistischen Philosophie sind Tiere seelenlose Automaten (bête-machine), ähnlich wie Uhren. Sie haben kein bewusstes Schmerzempfinden – ihre Schreie sind nur mechanische Reaktionen, wie das Quietschen einer Maschine.
Diese Vorstellung klingt heute absurd, aber sie hatte enorme praktische Konsequenzen. Margreiter weist auf die langfristigen Folgen hin: „Descartes’ Maschinenmodell beeinflusste den Behaviorismus und unterstützt bis heute Ideologien der Tierausbeutung” (Margreiter 2019).
Seltene Gegenstimmen
Vereinzelt gibt es auch in dieser Zeit kritische Denker. Michel de Montaigne (1533-1592) schreibt in seinen Essays über die „Anmaßung” (présomption) des Menschen, der sich für das Maß aller Dinge hält. Er beobachtet Tiere mit Respekt und Neugier und stellt fest: Vielleicht sind sie intelligenter, als wir denken – wir verstehen ihre Sprache nur nicht.
In England entstehen erste Tierschutzgesetze im 17./18. Jahrhundert – allerdings weniger aus philosophischer Überzeugung als aus pragmatischen Gründen (Verhinderung öffentlicher Grausamkeit, Schutz von Eigentum). Ähnlich wie heute gibt es auch in der Entwicklung der Tierethik große Berührungspunkte mit wirtschaftlichen Erwägungen, aber das ist ein anderes Thema….
Die Moderne: Revolution im Denken
Jeremy Bentham und der Utilitarismus
Der Durchbruch kommt 1789. Jeremy Bentham (1748-1832), Begründer des Utilitarismus, schreibt einen Satz, der die Tierethik revolutioniert:
„The question is not, Can they reason? nor, Can they talk? but, Can they suffer?”
„Die Frage ist nicht: Können sie denken? Können sie sprechen? Sondern: Können sie leiden?” (Bentham 1789)
Bentham verschiebt den Fokus von Vernunft auf Leidensfähigkeit (sentience). Wenn Tiere leiden können – und daran zweifelt im späten 18. Jahrhundert niemand mehr –, dann müssen ihre Interessen moralisch berücksichtigt werden. Nicht weil sie Vernunftwesen sind, sondern weil sie Schmerzempfindung haben.
Der Utilitarismus will das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl. Und „Zahl” meint hier: alle empfindungsfähigen Wesen, nicht nur Menschen. Das ist ein radikaler Bruch mit der anthropozentrischen Tradition.
Arthur Schopenhauer: Mitleidsethik
Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer (1788-1860) geht einen anderen Weg. Seine Mitleidsethik basiert auf der Idee, dass zwischen allen Lebewesen eine tiefe Verbundenheit besteht. Alle sind Manifestationen desselben Weltwillens. Mitgefühl ist keine sentimentale Schwäche, sondern ethische Pflicht.
Schopenhauer kritisiert Kant scharf: Dessen Ethik, die nur auf Vernunft und Pflicht baut, lässt Tiere außen vor – ein unentschuldbarer Mangel. Auch die christliche Tradition greift er an: „In Europa wurzelt die schmähliche Geringschätzung der Tiere im Judentum”, schreibt er polemisch (Schopenhauer 1840).
Schopenhauers Einfluss auf die deutsche Philosophie und Tierrechtsbewegung ist enorm, auch wenn seine Schriften oft misanthropisch und weltverneinend klingen.
Charles Darwin: Evolutionstheorie
1859 erscheint On the Origin of Species und mit ihm bricht ein wissenschaftliches Weltbild zusammen. Charles Darwin zeigt: Es gibt keine scharfe Grenze zwischen Mensch und Tier. Wir sind alle Teil desselben evolutionären Prozesses. Die Unterschiede sind graduell, nicht prinzipiell.
In The Descent of Man (1871) schreibt Darwin: Auch Tiere haben Emotionen, Intelligenz, soziale Bindungen, sogar moralische Impulse (Fairness, Empathie, Kooperation bei Primaten). Die „Scala Naturae” ist Vergangenheit. Die Hierarchie weicht der Kontinuität.
Margreiter betont die Bedeutung: „Darwin und Uexküll haben genuin nicht-antike wissenschaftliche Ansätze zum Verständnis von Tieren entwickelt” (Margreiter 2019). Darwin gibt der Tierethik eine empirische Basis. Die Frage ist nicht mehr nur philosophisch, sondern auch biologisch: Was zeigt uns die Wissenschaft über tierische Fähigkeiten?
Gegenwart: Die modernen Positionen
Peter Singer: „Animal Liberation” (1975)
Mit diesem Buch beginnt die moderne Tierrechtsbewegung. Peter Singer, australischer Philosoph, führt Benthams Utilitarismus konsequent zu Ende: Wenn Leidensfähigkeit zählt, dann ist Speziesismus – die Diskriminierung aufgrund der Spezieszugehörigkeit – moralisch genauso verwerflich wie Rassismus oder Sexismus.
Seine zentrale These: „All animals are equal” (Singer 1975). Alle Tiere sind gleich. Damit meint er: Gleiche Interessen verdienen gleiche Berücksichtigung, egal ob Mensch oder Tier. Das heißt nicht, dass Tiere und Menschen identische Rechte haben müssen (ein Schwein braucht kein Wahlrecht). Aber ihr Interesse, nicht zu leiden, zählt gleich viel wie unseres.
Praktische Konsequenz: Massentierhaltung, Tierversuche für triviale Zwecke, Jagd zum Vergnügen … all das ist moralisch nicht zu rechtfertigen.
Singers Position ist umstritten, auch wegen seiner Ansichten zu Euthanasie und „marginal cases” (Menschen mit schweren Behinderungen). Aber sein Einfluss ist unbestritten.
Tom Regan: Rechtebasierter Ansatz
Tom Regan (1938-2017) kritisiert Singer aus einer anderen Richtung. Utilitarismus, sagt Regan, ist nicht genug. Auch wenn wir das Gesamtglück maximieren, können wir Individuen schaden; und das ist falsch.
Regans Alternative: Tierrechte. Seine zentrale These: „The case for animal rights” (Regan 1983) – Tiere haben inhärente Rechte. Sie sind nicht nur leidensfähig, sondern „subjects-of-a-life”. Subjekte eines Lebens mit Bewusstsein, Erinnerungen, Gefühlen, Zukunftsvorstellungen. Sie haben einen inhärenten Wert (inherent value), der unabhängig von ihrem Nutzen für andere besteht.
Daraus folgen moralische Rechte: auf Leben, auf Unversehrtheit, auf Würde. Diese Rechte sind unveräußerlich – man kann sie nicht gegen Nutzenerwägungen aufrechnen.
Praktische Konsequenz: Noch radikaler als Singer. Tiere dürfen nicht nur nicht unnötig leiden. Sie dürfen grundsätzlich nicht für menschliche Zwecke benutzt werden (kein Fleischkonsum, keine Tierversuche, keine Zoos, keine Haustiere).
Christine Korsgaard: Kantianische Tierethik
Christine Korsgaard, Harvard-Philosophin, unternimmt etwas Überraschendes: Sie zeigt, dass man auch aus Kants Ethik – die traditionell anthropozentrisch ist – Pflichten gegenüber Tieren ableiten kann.
Ihr Werk Fellow Creatures: Our Obligations to the Other Animals (Korsgaard 2018) argumentiert: Kants kategorischer Imperativ verlangt, dass wir andere nie nur als Mittel, sondern immer auch als Zweck an sich selbst behandeln. Korsgaard zeigt: Diese Würde kommt allen Lebewesen zu, die Zwecke verfolgen und Werte haben und also auch Tieren.
Tiere sind Selbstzwecke, keine bloßen Werkzeuge. Wir schulden ihnen Respekt, weil sie eine eigene Perspektive auf die Welt haben, eigene Ziele verfolgen, ihr Leben aus ihrer Sicht wertvoll ist.
Praktische Konsequenz: Ähnlich wie Regan, aber mit kantianischer Begründung. Keine Instrumentalisierung von Tieren.
Care-Ethik und feministische Perspektiven
Die Care-Ethik (Carol Gilligan, Virginia Held) kritisiert abstrakte Rechte- und Nutzenkalküle. Ethik, so die Grundidee, ist nicht primär eine Sache abstrakter Prinzipien, sondern konkreter Beziehungen, Fürsorge, Verletzlichkeit.
Carol Gilligan schreibt in In a Different Voice (Gilligan 1982), dass moralisches Denken nicht nur durch Gerechtigkeit und Rechte, sondern auch durch Fürsorge und Verantwortung strukturiert sein sollte. Virginia Held entwickelt dies in The Ethics of Care (Held 2006) weiter: Care-Ethik bietet relationale Rahmen jenseits von Rechten oder Utilitarismus.
Feministische Tierethik (Josephine Donovan, Carol Adams) weist darauf hin, dass die Dominanz über Tiere historisch oft mit männlichen Machtstrukturen verknüpft war: Jagd als Männlichkeitsritual, Fleischkonsum als Symbol von Stärke, Tierausbeutung als Teil patriarchaler Herrschaft über die „Natur”.
Was bedeutet das heute? Praktische Relevanz
Nach 2,500 Jahren Philosophiegeschichte: Wo stehen wir? Und was bedeutet das für unseren Alltag?
Massentierhaltung
Die industrielle Tierhaltung mit Millionen Schweinen, Hühnern, Rindern auf engstem Raum wäre mit keiner der hier vorgestellten Positionen (außer vielleicht dem strengsten Anthropozentrismus) zu rechtfertigen. Selbst wenn man annimmt, Tiere dürften genutzt werden: Die Leiden in der Massentierhaltung sind so enorm, dass sie selbst unter utilitaristischen Gesichtspunkten (Minimierung von Leid) nicht zu verteidigen sind.
Tierversuche
Die Debatte ist komplexer. Singer würde sagen: Wenn ein Tierversuch echter wissenschaftlicher Fortschritt bringt und gravierendes menschliches Leiden verhindert, kann er gerechtfertigt sein. Jedoch nur, wenn wir den gleichen Versuch auch an einem Menschen durchführen würden, der kognitiv auf dem Level des Tiers ist. Regan und Korsgaard lehnen Tierversuche ab: Tiere haben Rechte, die man nicht verletzen darf, auch nicht für den Nutzen anderer.
Jagd und Naturnutzung
Jens Tuider und Ursula Wolf analysieren in ihrer einflussreichen Studie die ethischen Probleme der Jagd. Ihre Kernthese:
„Zur Jagd gehört nach üblicher Definition das Aufspüren, Verfolgen und Erlegen von Wild. Verfolgung führt beim Tier zu Angst und Stress”
(Tuider/Wolf 2013: 33).
Sie argumentieren weiter: „Das einzige Ziel, für dessen Realisierung die Jagd im engeren Sinn unerlässlich ist, ist die Erfüllung der Jagdleidenschaft” (ebd.: 48). Alle anderen angeblichen Rechtfertigungen wie Populationskontrolle, Ökosystemmanagement, und kulturelle Identität ließen sich auch mit nicht-tödlichen Alternativen erreichen.
Ihre Schlussfolgerung ist klar: „Jedes solche Leiden ist, wo wir es ohne Not zufügen, zu viel” (ebd.: 60). Philosophisch betrachtet könne Jagd nicht ethisch gerechtfertigt werden, angesichts verfügbarer Alternativen und vorhersehbarer Schmerz- und Stresszufügung.
Vegetarismus und Veganismus
Plutarch und Porphyrios hätten sich gefreut: Die philosophischen Argumente für pflanzliche Ernährung sind heute so stark wie nie. Ob utilitaristisch (Leidvermeidung), rechtebasiert (kein Töten) oder aus Care-Perspektive (Verantwortung für Verwundbare) – alle führen tendenziell zu vegetarischer oder veganer Lebensweise.
Natürlich gibt es Gegenargumente: Tradition, Kultur, Geschmack, Bequemlichkeit. Aber philosophisch sind sie schwach.
Rechtliche Entwicklungen
In Deutschland ist Tierschutz seit 2002 Staatsziel im Grundgesetz (Art. 20a GG):
„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung (…).”
Art. 20a GG
Das ist bemerkenswert, zeigt aber auch die Grenzen: „Im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung” bedeutet, dass Tiernutzung weiterhin legal bleibt, solange sie „verhältnismäßig” ist. Jagd, Landwirtschaft, Tierversuche sind erlaubt, auch wenn sie Tieren schaden.
Die philosophische Diskussion geht weiter: Sollten Tiere juristische Rechte bekommen? Sollten sie als Rechtspersonen anerkannt werden, mit Anwälten, die ihre Interessen vertreten? Martha Nussbaums jüngstes Werk Justice for Animals: Our Collective Responsibility (Nussbaum 2023) argumentiert genau dafür.
–> Deutsche Übersetzung: Gerechtigkeit für Tiere: Unsere kollektive Verantwortung
Zukunftsfragen
- Klimawandel: Fleischproduktion ist einer der größten CO₂-Treiber. Tierethik und Umweltethik überschneiden sich.
- Künstliche Intelligenz: Wenn KI leidensfähig wird, haben wir dann auch ihr gegenüber Pflichten?
- Synthetisches Fleisch: Wenn Fleisch ohne Tierleid produziert werden kann – entfällt dann das ethische Problem?
Exploring the Future: Instructional Design and AI
Fazit: Von der Hierarchie zur Gleichheit und zurück?
Die Geschichte der Tierethik ist eine Geschichte der Ausweitung moralischer Berücksichtigung. Von der antiken Hierarchie (Tiere als Werkzeuge) über mittelalterliche Stagnation (Tiere als Mittel) zur modernen Gleichheit (Tiere als Rechtsträger, Mitgeschöpfe, Subjekte).
Aber es ist keine Fortschrittsgeschichte im einfachen Sinne. Auch heute gibt es Anthropozentriker, die Descartes und Aristoteles zustimmen würden. Die Debatten sind offen, die Antworten umstritten.
Was wir aus der Geschichte lernen können:
- Philosophie ist nie neutral. Margreiter bringt es auf den Punkt: „Sehr oft folgen die Philosophen bloß dem kulturellen Mainstream und geben ihm eine begrifflich-theoretische Gestalt” (Margreiter 2019). Oft rechtfertigt Philosophie bestehende Praktiken, statt sie kritisch zu hinterfragen.
- Wissenschaftliche Erkenntnisse verändern ethische Debatten. „Heute stehen uns zoologische Erkenntnisse in einem Ausmaß zur Verfügung, von denen man früher nur hat träumen können” (ebd.). Darwin, moderne Kognitionsforschung, Verhaltensbiologie: je mehr wir über Tiere wissen, desto schwerer wird es, ihnen moralischen Status zu verweigern.
- Dissidente Stimmen gab es immer. Antike Philosophen haben bereits die meisten modernen Argumente der Tierethik Jahrhunderte vor zeitgenössischen Denkern formuliert. Plutarch, Theophrast, Montaigne – in jeder Epoche gab es Philosophen, die das Mainstream-Denken infrage stellten. Ihre Argumente sind heute aktueller denn je.
- Ethik ist praktisch. Die Frage „Welchen moralischen Status haben Tiere?” ist nicht akademisch – sie betrifft unseren Speiseplan, unsere Gesetze, unseren Umgang mit der Welt.
Vielleicht der wichtigste Punkt: Historisches Verständnis hilft uns, besser zu argumentieren. Wer die lange Geschichte der Tierethik kennt, kann nicht mehr einfach sagen: „Tiere essen ist natürlich, das haben wir immer gemacht.” Denn Philosophen haben immer schon darüber nachgedacht und viele sind zu anderen Schlüssen gekommen.
Die Debatte geht weiter. Aber sie ist keine neue Debatte. Sie ist 2,500 Jahre alt, und gerade deshalb so reich, komplex und faszinierend.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Tierethik
Wer gilt als Begründer der modernen Tierethik und welche zentrale Frage stellte er?
Der Begründer des Utilitarismus, Jeremy Bentham, gilt oft als zentraler Denker der modernen Tierethik. Im Jahr 1789 verschob er den Fokus von Vernunft und Sprache zur Leidensfähigkeit (sentience). Seine revolutionäre Frage lautete: „Die Frage ist nicht: Können sie denken? Können sie sprechen? Sondern: Können sie leiden?“.
Wie begründete Aristoteles die Unterordnung der Tiere unter den Menschen?
Aristoteles zog eine scharfe Grenze, indem er den Menschen als einziges Lebewesen ansah, das über Vernunft/Sprache (Logos) und die Fähigkeit zur Organisation gerechter politischer Gemeinschaften (zoon politikon) verfügt. Seine hierarchische Sichtweise, bekannt als die Scala Naturae, besagt, dass “Pflanzen existieren für die Tiere, Tiere und Pflanzen für den Menschen”.
Was ist der entscheidende Unterschied zwischen Peter Singers Utilitarismus und Tom Regans Rechte-Ansatz?
Peter Singer (Utilitarismus) argumentiert, dass die Interessen von Tieren gleichwertig berücksichtigt werden müssen, wenn sie leidensfähig sind, und bekämpft den Speziesismus. Tom Regan hingegen kritisiert den Utilitarismus. Er argumentiert für Tierrechte, da er Tiere als “subjects-of-a-life” mit einem “inhärenten Wert” ansieht, der ihnen unveräußerliche Rechte auf Leben und Unversehrtheit verleiht, unabhängig von ihrem Nutzen für den Menschen.
Welche Rolle spielte René Descartes in der Geschichte der Tierethik?
René Descartes vertrat eine radikal abwertende Position: Er sah Tiere als seelenlose Automaten (bête-machine). In seiner mechanistischen Philosophie hatten Tiere kein bewusstes Schmerzempfinden; ihre Schreie waren lediglich mechanische Reaktionen, ähnlich dem Quietschen einer Maschine.
Gab es in der Antike bereits Gegenstimmen zur anthropozentrischen Sichtweise?
Ja, schon in der Antike gab es kritische Denker. Plutarch argumentierte gegen Fleischkonsum und warnte, dass Rohheit gegenüber Tieren zu Rohheit gegenüber Menschen führe. Theophrast forderte rücksichtsvolle Behandlung aufgrund biologischer Ähnlichkeit. Auch die Pythagoräer praktizierten Vegetarismus aus dem Glauben an die Seelenwanderung (Metempsychose).
Inwiefern hat Charles Darwin die philosophische Debatte verändert?
Charles Darwins Evolutionstheorie führte zum Zusammenbruch des hierarchischen Weltbildes der “Scala Naturae”. Er zeigte, dass die Unterschiede zwischen Mensch und Tier graduell, nicht prinzipiell, sind. Darwin gab der Tierethik eine empirische Basis, indem er belegte, dass auch Tiere Emotionen, Intelligenz und soziale Bindungen besitzen.
Literaturverzeichnis
Primärquellen (Antike)
- Aristoteles: Nikomachische Ethik, Politik, Historia animalium, De partibus animalium, De anima, Metaphysik
- Hesiod: Werke und Tage
- Homer: Ilias, Odyssee
- Platon: Politeia (Der Staat)
- Plutarch: Moralia (enthält: De sollertia animalium, De esu carnium, Bruta animalia ratione uti)
- Porphyrios: De abstinentia (Über die Enthaltung vom Beseelten)
- Theophrast: Fragmente zur Tierethik
Sekundärliteratur (Antike und Geschichte)
- Dierauer, Urs (1977): Tier und Mensch im Denken der Antike. Amsterdam: Grüner
- Lorenz, Günther (2000/2013): Tiere im Leben der alten Kulturen. Wien/Köln/Weimar: Böhlau
- Haussleiter, Johannes (1935): Der Vegetarismus in der Antike. Berlin: Alfred Töpelmann (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten)
- Sorabji, Richard (1993): Animal Minds and Human Morals: The Origins of the Western Debate. Ithaca: Cornell University Press
- Margreiter, Reinhard et al. (2019): Essay über Tiere in der antiken Philosophie. Universität Innsbruck
Moderne Tierethik (Hauptwerke)
- Bentham, Jeremy (1789): An Introduction to the Principles of Morals and Legislation
- Darwin, Charles (1859): On the Origin of Species
- Darwin, Charles (1871): The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex
- Gilligan, Carol (1982): In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development
- Held, Virginia (2006): The Ethics of Care: Personal, Political, and Global
- Korsgaard, Christine M. (2018): Fellow Creatures: Our Obligations to the Other Animals. Oxford: Oxford University Press
- Nussbaum, Martha C. (2023): Justice for Animals: Our Collective Responsibility. New York: Simon & Schuster
- Regan, Tom (1983): The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press
- Schopenhauer, Arthur (1840/1860): Die beiden Grundprobleme der Ethik (enthält: Über die Grundlage der Moral)
- Singer, Peter (1975/2009): Animal Liberation: The Definitive Classic of the Animal Movement. New York: Harper Perennial
- Tuider, Jens / Wolf, Ursula (2013): „Gibt es eine ethische Rechtfertigung der Jagd?”, in: TIERethik 5/2013, Heft 7, S. 32-62
- Wolf, Ursula (2012): Ethik der Mensch-Tier-Beziehung. Frankfurt am Main: Klostermann
Deutsche Tierethik und angewandte Ethik
- Ach, Johann S. / Borchers, Dagmar (Hrsg.) (2018): Handbuch Tierethik: Grundlagen – Kontexte – Perspektiven. Stuttgart: J.B. Metzler
- Ladwig, Bernd (2020): Politische Philosophie der Tierrechte. Berlin: Suhrkamp
Weiterführende Ressourcen
- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb): Themenschwerpunkt Tierethik
- Stanford Encyclopedia of Philosophy: “The Moral Status of Animals”
- Internet Encyclopedia of Philosophy: “Animal Ethics”
- TIERethik – Zeitschrift für Mensch-Tier-Beziehungen: Fachzeitschrift
Lust auf mehr Philosophie? Erfahre mehr über Platons Gerechtigkeitsvorstellung in der Politeia und die Nikomachische Ethik des Aristoteles, die beide zentrale Rollen in der Geschichte der Tierethik spielen.
